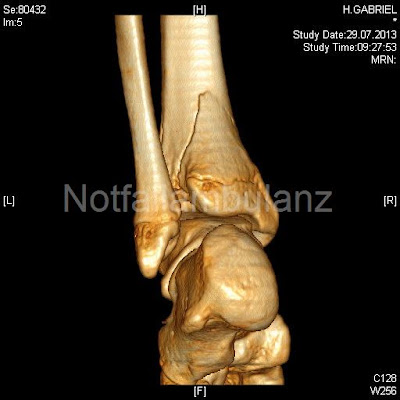Ein Team um den Epidemiologen John
Mathews von der University of Melbourne in Carlton hat die
Krankenversicherungsdaten von rund elf Millionen Patienten ausgewertet.
680.211 von ihnen waren zwischen 1985 und 2005 in eine CT-Röhre
geschoben worden. Zu diesem Zeitpunkt waren sie höchstens 19 Jahre alt
gewesen. Um die Möglichkeit auszuschließen, dass die CT bereits Teil der
Tumordiagnostik gewesen war, durften etwaige Malignome nicht früher als
ein Jahr nach der radiologischen Untersuchung aufgetreten sein.
Altersabhängiges Risiko
Insgesamt
waren bei den Probanden während einer durchschnittlichen Follow-up-Zeit
60.674 Malignome aufgetreten, 3150 davon in der CT-Gruppe. Bei den
computertomografisch untersuchten Studienteilnehmern lag die
Krebsinzidenz um 24% höher als bei den Vergleichspersonen, bei denen
keine CT gefahren worden war. Jede weitere CT erhöhte die Inzidenz um
16%. Das Krebsrisiko korrelierte mit dem Alter der Patienten zum
Zeitpunkt der CT: Es lag bei den Ein- bis Vierjährigen um 35%, bei den
Fünf- bis Neunjährigen um 25%, bei den 10- bis 14-Jährigen um 14% und
bei den über 15-Jährigen um 24% höher.
Die Zahl zusätzlicher
Krebserkrankungen unter den Patienten, die eine CT – durchschnittliche
Strahlendosis: 4,5 mSv – hinter sich hatten, bezifferten Mathews und
seine Mitarbeiter auf 608: 147 Hirntumoren, 356 andere solide Tumoren,
48 Leukämien oder Myelodysplasien und 57 sonstige lymphoide Malignome.
Die überschießende Inzidenz gaben die Forscher mit 9,38/100.000
Personenjahre an.
Alternativen nutzen, wo es nur geht
Auch
wenn vermutlich nicht alle überzähligen Tumoren auf die CT
zurückzuführen sind – vor allem bei Hirntumoren könnte der Vorlauf von
einem Jahr zwischen CT und Diagnose zu gering bemessen sein –, spricht
laut Mathews doch vieles für die CT-Strahlen als wesentliche Ursache.
Beispielsweise erbrachten Analysen mit Vorlaufzeiten von fünf und von
zehn Jahren zwar niedrigere, in der Verteilung aber ähnliche
Inzidenzsteigerungen. Auch der Ausschluss von Hirntumoren, die nach
einem Schädel-CT auftraten, aus der Analyse veränderte die Resultate
nicht substanziell.
Die Konsequenzen aus ihren Resultaten liegen
für die Australier auf der Hand. „Es muss sichergestellt werden, dass
die CT-Diagnostik auf Situationen beschränkt bleibt, in denen
eine klare
klinische Indikation besteht, und es muss die jeweils niedrigstmögliche
Dosis gewählt werden.
Nicht radiologisch
tätige Ärzte, die ja die meisten CT-Untersuchungen veranlassten, müssten
der potenziellen Risiken gewärtig sein. Zum Beispiel würden viele CT
angeordnet, um Schädeltraumen geringeren Grades oder den Verdacht auf
eine Appendizitis abzuklären. Beobachten des
Patienten, Ultraschall- und Kernspinuntersuchungen böten sich hier als
Alternativen an.
Anmerkung: Überlegen Sie sich daher genau, welchen Nutzen Sie von der Untersuchung erwarten und ob die Indikation gerechtfertigt und eine vitale ist.
Mathews.
J. D. et al. Cancer risk in 680.000 people exposed to computed
tomography scans in childhood or adolescence: data linkage study of 11
million Australians. BMJ 2013 online 22. Mai; doi: 10.1136/bmj.f2360
.jpg)
.jpg)